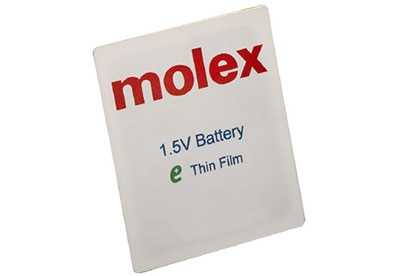Wann endlich findet Starkstromtechnik die nötige Anerkennung?
Elektrotechniker genießen im Allgemeinen in der Öffentlichkeit große Anerkennung, und doch gilt diese Anerkennung nicht für alle Vertreter dieser Zunft gleichermaßen. Konstrukteure energiesparender Systeme werden von den Kritikern gelobt: „Kaum zu glauben, was sie geschaffen haben, und es läuft seit Wochen mit einer winzigen Batterie!“ Das gleiche gilt für Ingenieure, die den Großteil ihrer Arbeitszeit vor dem Computer verbringen: „Sie dir diese junge Dame an, sie kann programmieren, also hat sie beste Zukunftschancen!“
Gut, ich habe meine Vorurteile gegenüber Hardware- oder Schaltkreisingenieuren, aber ich erkenne an, dass für ein Projekt in der Regel eine Vielzahl von technischen Fähigkeiten erforderlich sind. Daher: Okay, auch ich zolle diesen Superenergiespar- und Computeringenieuren ihre gebührende Anerkennung.
Und dennoch scheint es eine ein noch weitgehend unbemerkte Gruppe unter den Elektrotechnikern zu geben, die wenig Aufmerksamkeit oder Bestätigung für die Herausforderungen bekommt, denen sie sich täglich stellen. Ich rede von denjenigen, die es mit höheren Leistungswerten zu tun haben, also mit mehreren Hundert Volt und Ampere und zweistelligen Kilowattwerten. Manche mögen behaupten, das liegt daran, weil diese Anwendungen weit von der öffentlichen Wahrnehmung entfernt sind, doch das ist überhaupt nicht der Fall. Diese Starkstromanwendungen beschränken sich nicht auf solche, mit denen der Verbraucher kaum zu tun hat, etwa Industrieanlagen oder 25-Kilovolt-Oberleitungen für den elektrifizierten Bahnbetrieb.
Nehmen wir nur das Elektrofahrzeug, mit denen viele Verbraucher bereits direkt oder zumindest indirekt Kontakt hatten. Die Akkus der Elektrofahrzeuge haben eine Energiekapazität im Bereich von rund 25 Kilowattstunden bis über 70 Kilowattstunden, und diese Akkus liefern Spannungen von 300 Volt bis 400 Volt bei zirka 1000 Ampere Stromstärke (die Elektromotoren dieser Fahrzeuge können bis zu 300 Pferdestärken oder mehr leisten). Alle diese Werte – Energiekapazität, Spannung, Stromstärke – bedeuten, dass die Akkus, die Energieumwandlung, das Energiemanagement und die Energieverteilung bei Elektrofahrzeugen ziemlich ernste Problemstellungen sind, wenn es um Konstruktion, Erprobung und Wartung dieser Fahrzeuge geht.
Doch der Unterschied zwischen diesen Konstruktionsumgebungen ist nicht nur eine Frage der reinen Zahlen oder des numerischen Maßstabs. Stattdessen bedarf es einer ganz anderen Mentalität und Herangehensweise, um all das in der Welt des Starkstroms zu bewerkstelligen. Beim Niederleistungsdesign ist es keine große Sache, mal eine andere Lösung temporär auszuprobieren, etwa einen Draht woanders zu verlegen und anzulöten oder einen schnellen improvisierten Test durchzuführen, um eine Idee zu erproben. Aber wenn man es mit höheren Leistungswerten zu tun hat, muss jede Aktion geplant, simuliert, evaluiert, ausgewertet und mehrfach geprüft werden, bevor sie tatsächlich erfolgen kann. Schließlich haben wir es hier mit eine erheblichen Menge an hochkonzentrierter Energie zu tun.
Und dann gibt es noch das Problem der Tests. Jeder Aspekt bei der Ermittlung, was das System gerade macht, und welche Auswirkungen Änderungen haben, erfordert einen sorgfältig konstruierten Testplan und eine entsprechende Testanordnung. Man kann hier nicht einfach mal so die Messkabel eines Digitalvoltmeters an die fraglichen Stellen anklemmen. Selbst eine eher routinemäßige Aufgabe wie etwa die Stromstärkemessung über einen Inline-Shunt erfordert eine sorgfältige Auswahl der Bauteile, der Schnittstellenschaltung, in vielen Fällen der galvanischen Trennung und sogar der Umsetzung der physischen Verbindungen.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie planen, mit einem Shunt-Widerstand die Stromstärke in einem Starkstromleiter zu messen. Das mag zwar eine bekannte Technik sein, doch es geht hier um Hunderte von Ampere in einem Elektrofahrzeug. Also müssen Sie den Wert des Shunt-Widerstand so klein wie möglich halten, um sowohl den IR-induzierten Spannungsabfall als auch die I2R-Wärmeabgabe des Messwiderstands zu verringern.
Zum Glück stehen dazu Standard-Shunts mit extrem niedrigen Widerstandswerten zur Verfügung. So hat zum Beispiel die Baureihe WSBS8518 von Vishay Dale Standardwerte von 100, 500 und 1000 µΩ (das sind lediglich 0,1, 0,5 und 1,0 mΩ) (Abbildung 1). Der Shunt, ein ganz gewöhnlich aussehender „Metallstreifen“ von etwa 85 mm Länge und 18 mm Bereite, besteht aus einer massiven Nickel-Chrom-Legierung, deren Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR) bei lediglich ±10 ppm/°C liegt.
 Abbildung 1: Dieser Shunt-Widerstand aus dem Mikroohm-Bereich (µΩ) sieht zwar im Vergleich zu anderen elektronischen Komponenten recht einfach aus, und doch handelt es sich dabei um ein aufwändig entwickeltes und hergestelltes Stück aus einer massivem Nickel-Chrom-Legierung mit sehr niedrigem Temperaturkoeffizient und Kelvinkontakten. (Bildquelle: Vishay/Dale)
Abbildung 1: Dieser Shunt-Widerstand aus dem Mikroohm-Bereich (µΩ) sieht zwar im Vergleich zu anderen elektronischen Komponenten recht einfach aus, und doch handelt es sich dabei um ein aufwändig entwickeltes und hergestelltes Stück aus einer massivem Nickel-Chrom-Legierung mit sehr niedrigem Temperaturkoeffizient und Kelvinkontakten. (Bildquelle: Vishay/Dale)
Aber wie würden Sie diesen Widerstand physisch mit den Lastleitungen verbinden? Schließlich würden schon einige wenige Milliohm (mΩ) Kontaktwiderstand zu Leistungsverlust und Spannungsabfall führen. Die Montage der Shunt-Verbindungen ist also ein weiteres Konstruktionsproblem. Außerdem müssen Sie ja auch noch die Kabel zur Spannungsmessung anschließen. Zum Glück verfügt dieser Shunt über integrierte Kelvinkontakte, was diese Aufgabe etwas einfacher macht; doch viele Shunts haben diese nicht.
Doch nicht allen „Leistungstechnikern“ mangelt es an Anerkennung; meiner Meinung nach sind es vor allem die Starkstromtechniker, die dieses Problem kennen. Als kürzlich an den 50. Jahrestag der Apollo-Mondlandung erinnert wurde, waren wir wieder von der Schubkraft begeistert, die von den fünf F-1-Raketentriebwerken erzeugt wurde, welche die die erste Stufe der Saturn-Trägerrakete antrieben (Abbildung 2).
 Abbildung 2: Es gibt weniger sichtbare Energie und solche, die nicht zu übersehen ist. Die Saturn-V-Trägerrakete mit ihren fünf F-1-Triebwerken gehört auf jeden Fall in die zweite Kategorie. (Bildquelle: NASA)
Abbildung 2: Es gibt weniger sichtbare Energie und solche, die nicht zu übersehen ist. Die Saturn-V-Trägerrakete mit ihren fünf F-1-Triebwerken gehört auf jeden Fall in die zweite Kategorie. (Bildquelle: NASA)
Die Zahlen sagen zwar alles und sind doch schwer vorstellbar: Die erste Stufe der Saturn-V-Rakete enthielt 203,400 Gallonen (770.000 Liter) Kerosinbrennstoff und 318,000 Gallonen (1,2 Mio. Liter) Flüssigsauerstoff. Jede F-1-Brennstoffpumpe wurde von einer 55.000-PS-Turbine angetrieben, um pro Minute etwa 15.000 US-Gallonen (knapp 60.000 l) Kerosin zu liefern, und die Pumpe für das Oxidationsmittel lieferte 25.000 US-Gallonen (94.000 l) Flüssigsauerstoff pro Minute. Jede Turbopumpe musste sowohl dem eingespeisten Brennstoff mit seinen 1500 °F (820 °C) als auch dem Flüssigsauerstoff mit -300 °F (-18 °C) standhalten. Beim Abheben produzierten die fünf Motoren einen Startschub von 7,5 Millionen Pfund (33851 kN).
Man denke nur an die Befestigungen, die nötig waren, um diese F-1-Motoren auf dem Prüfstand in ihrer Position zu halten, oder an die Haltebügel, die die Saturn nach der Zündung auf dem Startpodest festhielten, während die Raketentriebwerke auf ihre volle Leistung kamen. Sie mussten nicht nur dem enormen Schub standhalten, sondern dann auch die Rakete völlig reibungslos freigeben, und das in einer extremen Abgassituation (und wie testen Sie das?).
Ich denke, die sehr sichtbare Energie einer Rakete – ganz gleich, ob der Start erfolgreich ist oder nicht – verschafft den Raketenbauern von ganz allein die Anerkennung, die sie verdienen. Da jedoch elektrische Energie weniger „sichtbar“ ist, erhalten Techniker, die es mit elektrischem Strom zu tun haben, diese Anerkennung nicht. Die riesige Wolke der Raketenabgase macht die ganze Situation so real, während die Elektronen in einem Akku im Normalbetrieb in aller Stille ihre Aufgabe erledigen, weshalb das scheinbar „keine große Sache“ ist.
Werden Elektrotechniker, die es mit Werten im Starkstrombereich zu tun haben, künftig mehr Anerkennung finden? Das weiß ich natürlich nicht. Aber es wäre schön, denn Massenanwendungen wie Elektrofahrzeuge, Solarenergie und ein intelligenteres Stromnetz setzen ihr Fachwissen im Kilowatt- und Megawatt-Bereich voraus.
Referenzen:
1 – Roger E. Bilstein, „Stages to Saturn: A Technological History of the Apollo/Saturn Launch Vehicles“ (kostenlose 168-MB-Datei hier downloadbar; kostenloser Download der einzelnen Kapitel hier)
2 - Charles Murray u. Catherine Bly Cox, „Apollo: The Race to the Moon“
3 – Wikipedia, “F-1 (Raketentriebwerk)“

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum